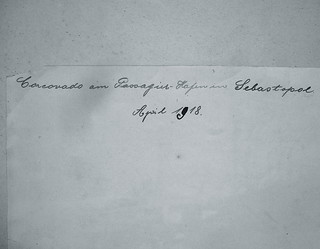Heidelberg, Diese stadtspatzen und wie sie widerhallten ohne autos am samstagmorgen. Erinnerte demzufolge kurz auch einen anderen morgen, einen Sonntagmorgen, helmut schmidt war gerade gestürzt.
Seit langem ist sie beim rundfunk. War mir immer eine gute freundin. Manchmal hör ich sie zufällig noch im radio ab und an, dann denk ich an sie und wie es ihr wohl geht. Dort hatte ich mir angesichts bevorstehend einer kleinen gemeinsamen parisreise elton johns „goodbye yellow brick road“ gekauft, ein für eine zugreise wahrhaft sinnloses doppelvinyl, dafür aber fürs spätere leben, dazu eine schmucke hose auf ihre erfahrene empfehlung hin, nach unten eng zulaufend modegemäß und in einem braun, welches nun Opel wiederentdeckt hat, wie mir gestern auffiel beim ausschritt aus der kirche.
Ich trug rötlichen doppelschnauzer und las umgehend „Du fährst zu oft nach Heidelberg“. Das erste mal seit meiner mutter hatte ich neben einem weiblichen menschen in einem gemeinsamen bett geschlafen und kein auge zugetan. Ich hatte für mich keine augen zugetan. Ich konnte noch nie ganz nah neben irgend jemandem anderen schlafen. Dann war klassik zum frühstück von kassette, wie in allen geisteshaushalten mit anspruch, und eben jene stadtspatzen. Man wird so oft alleine gelassen mit sich, aber das ist ja oft auch richtig so.
Die nachschau.
Auch die saarschleife bei mettlach und das erste mal schnecken zu essen. Das einzige mal bis heute. Nach den schnecken wollte ich rauchen und wusste nicht, ob dies zwischen zwei gängen der etikette nach in solch einem edlen restaurant erlaubt sei. Ihr vater gab mir feinsinnig zugewandt und sehr weise (leise) auf den weg, daß zunächst unvorbehaltlich erlaubt sei, was ich mir erlaube. Selbst hier. Das hatte mich sehr beeindruckt.
Ich war immerhin ein junger vaterloser mensch. Wir rauchten dann jeder einen seiner cigarillos und ich eine meiner zigaretten schnell dazu. Dabei hatte ich mir morgens beim rasieren vor aufregung dieses saarlandes in die kottelette geschnitten. Wie mir das immer passierte, wenn es jemals drauf ankommt, bis heute. Ein gutes zeichen und schönes bild allemale.
Ich trug also rötliches pflaster und rötlichen schnauzer in einem kleinen feinen saarländischen restaurant mit dem namen „l’escargot“. Der koch war dick und zündelte schwitzend irgendetwas am tisch. Ich empfand seine ausstrahlung obgleich seiner immensen körperfülle als sehr sinnlich, er war eins mit seiner geübten flambiererei und trug funkelnde schweissperlen auf der stirn, die merkwürdigerweise auf nichts heruntertropften. Ein überaus runder mensch eben, ganz und gar im Eros seines gegebenen selbst. Auch das habe ich mir dann äußerst fürs leben gemerkt, für meine werkseinstellungen.
Seit jahr nun wieder einmal in heidelberg, ich war angetan und wohlfühlend. Auch von den gastgebern. Ein richtiger strom ist der neckar dort, kurz bevor er aufgesogen wird, geschlürft wie schnecken. Denn auch die köchin hatte einst dinge und sachen in heidelberg. Eine lebensform, die derzeit außer interesse und damit auch konkurrenz. Hat sie mir vieles gezeigt und erzählt.
Die zeiten sollten vielleicht magerer werden, um sich dessen zu erinnern. Es ist alles rand am topf. Jeder tropfen, der überquillt, verdampft oder verbrennt. Oder bestenfalls verdunstet. Vor allem: Es ist nichts mehr übrig an VORSTELLUNG. Jeder gedanke ist bereits gewusst, immer und überall. So kommt mir das vor. Viel mehr noch, als nichtmal geteilt.
/Genauso ÜBRIGENS die kontextuale bildende kunst. Was für eine lehrende balz. Was für eitelkeiten. Das Übrigens als kurve. Bestenfalls werden gute ideen zu kunst umformuliert. Mir gefällt nicht mehr, wer sich da alles tummelt und/oder mittlerweile die drängelnden koordinaten vorgibt. Das ist mir alles zu lesbar geworden. Lesbar noch von den letzten zwar vielleicht klugen, jedoch visuell Minderbegabten. Bildnerisches geheimnis und sprache sind unerwünscht, da nicht verstehbar, sie werden schlicht nicht mehr wahrgenommen und damit dann auch nicht mehr gezeigt. Ganz selten vielleicht. Oder zu spät mit viel tamtam, dann.
Nach Tod vermittelbar. Geheimnissen. Klänge blöde, Kinderkram und doch.
Im grunde gibt es ja kaum noch eigentliche „Bildwerke“, sondern lediglich gerade noch gelegt hochprofessionell kreditproduzierte gedankenvorgänge in groß, deren verdrahtung stets mitgeliefert wird oder selbsterklärend ist. Oder aufgrund einer modern sinnfreien abstraktion nicht mehr erklärt werden muss, für diesen fall wird die weisse blase eines ungeübten nihilismus dann nebst sonnenbrille mitgeliefert. Informationsreihungen, -produkte. Fein. An die visionslosigkeit wurde sich ja schon gewöhnt, nur diese kann man erst haben, hatte man einst welche.
Der erwerb der fähigkeit zur VORSTELLUNG nimmt ab. In meiner beschränktheit.
Vorstellungen sind wie gute frische sonntagsbrötchen aus weissmehl mit dick kaltbutter und (ggf. selbergemachter) brombeermarmelade. Dazu die stadtspatzen. Und etwas vielleicht, was sich lohnt, es zu erzählen oder zu bebildern, da es gelebt. Wenigstens: vorgestellt.
Zeichen. Wir lachen aufgeklärt über Zeichen. Zeichen sind etwas für völker der natur, grenzenlose Milde.
In heidelberg könnte ich mir sogar irgendein leben vorstellen. Mannheim und ludwigshafen sind nicht weit. Der wilde odenwald (angeblich eine hölle) auf der anderen seite in geographie. Das würde sogar die existenz einer altehrwürdigen universität lindern. Das doppelalbum goodbye yellow brick road ist eines meiner gehüteten klassiker. Insbesondere der titel „Bennie and the Jets“ passt mir immer noch braune unten enge hosen an. Ich bin in meiner Vorstellung auf der suche nach silbernen turnschuhen dazu.
Morgen ist karfreitag und alle reden übers tanzverbot, welch’ Luxus.