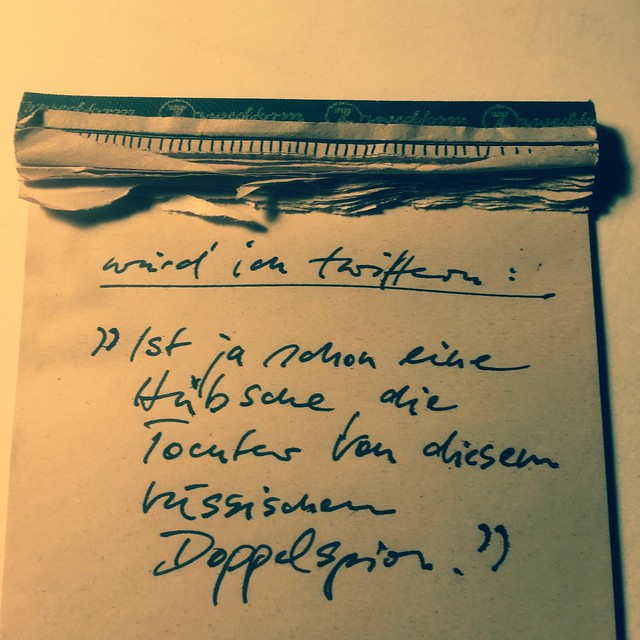Seltsame Blüten, da gratulieren bei Zuckerberg Leute Leuten zum Geburtstag, obgleich die beglückwünschte Person vor bereits einem halben Jahr verstorben ist. Sogar „herzlich“. Oder sie wünschen schlicht „Best!“. Mit Ausrufezeichen, gar aufpoppenden Herzchen. Es sind ja oft diese kleinen Erledigungsfallen, gerne im Prominentenzusammenhang. Zeigen, wen man kennt. Auch wenn man nicht beachtet. Die Info übers Ableben ist eben durchgerutscht. Und noch schlimmer: Diese Peinlichkeit interessiert niemanden. Schön finde ich das nicht. Nicht nur, weil es sich nicht gehört.
Dazu: Alle geben ja jetzt ihre Auszeichnungen zurück, die Musiker ihre Echos und die Giftgasdiktatoren die Medaillen der Fremdenlegion. Auch ich gebe nun meine sämtlichen Preise und Medaillen hiermit alle vorbeugend zurück. Bevor sie mir noch aus irgendeinem Grund aberkannt werden. Das wäre ja noch schöner. Gegen moralische Zweitverwertung lässt sich ja nichts einwenden.
(Und wer lässt sich heute schon noch verprügeln für seine Überzeugungen.)
Am vergangenen Sonntag, nach einer langen Zugfahrt auf Gangplatz ab Südkreuz, gewollt und selbstentscheiden ohne weitere Beschäftigung über sieben Stunden, als dem reinen Nachdenken und endlich einmal ziellosem Dösen, dachte ich in mein kleines Kopftagebuch hinein:
„Imgrunde habe ich mein ganzes Leben lang meinen Bauch eingezogen.“
Egal, ob ich gerade einen kleinen hatte, oder ob ich, in anderen Jahren, aussah, als wäre ich irgendeiner Kriegsgefangenschaft frisch und mit erheblichen Mängeln entlassen.
#
Der Satz mit dem Baucheinziehen gefällt mir. Weil er so schön nach Kulturtheater klingt und nach inszeniertem Lebenswerk. Wie ein Selfie voll mindestens doppelt gebrochener Weisheit. Und weil er so blöde ist. Am Ende und durchgedacht, genudelt, im Pansen. Haarscharf an einem Horizont vorbei, den ich nicht will. Und den ich nicht mag. Und andererseits, weil es stimmt. Das mit dem Bauch. Eine Art Anzug, vielleicht meinem Alter entsprechend. Kein weisses Hemd, eher vielleicht ein schlichtes Langärmchen mit V-Ausschnitt, ohne Allüre oder Linkswaschen allerdings, bitte.
Ich bin nicht reif, höchstens vielleicht gereift. Aber ein Apfel bin ich auch nicht oder eine Birne. Wenn man gereift ist, dann gehts nicht weiter, dann fällt man irgendwo runter. Im besten Fall wird man dann von Irgendjemandem eingesammelt. Zu einem Zweck, bei dem man nicht mitreden konnte. Immer, wenn ich eine Birne werden sollte, dann habe ich die kurz vorher in eine Hecke geworfen, halbgegessen. Das Kernhäuschen der kleinen Äpfel ebenso. Gematscht, gespuckt. Auch die grüne Mitte von Karotten. Ich mochte mich so ungern auflesen lassen.
Gespuckt in irgendeinen Winkel, seis Natur, seis Bolzplatzgrün oder auf Hänge von Gleisen. Wahrscheinlich lebe ich deshalb noch. Wegen der fehlenden Wertschätzung von Sinn. Meiner gesteuerten Gesamtverweigerung von Erkenntnis. Und so soll es auch bleiben. Nur so funktioniere ich. Krieg ich Luft. Im Baucheinziehen oder Rausstrecken. So einfach scheine ich geschaffen worden zu sein. Oder eben offenbar gedacht, geplant, angelegt: Irgendwas mit Kompost.
Ich verneige mich und meinen Bauch vor diesem Mulch, woher auch immer dieser rührt, für den ich nichts kann. Ich habe keine Ahnung. Selbst mutzumaßen weigere ich mich aus Demut. Zuletzt denkt man dann ja an Spirituelles. Schwamm drüber, Glück gehabt. Einfach weitermachen. Aber wenns mich mal erwischt, dann soll keiner mir mehr zum Geburtstag unter die Krume gratulieren. Und schon gleich gar nicht im Gottesacker Internet.