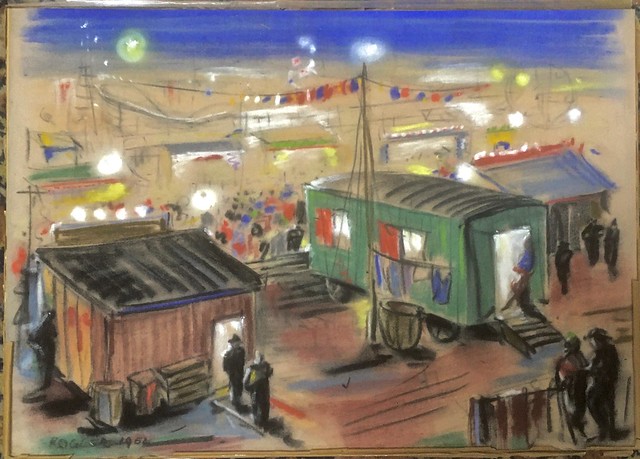—
Vor mehr als dreißig Jahren, um das Jahr 1988 herum, verreiste die alte Dame für 12 Wochen nach Nordamerika. Und wie immer vor solchen Reisen plante sie, ihren wertvollsten Schmuck, meist alte Familienstücke, in ihr Tresorfach bei der Kreissparkasse für die Dauer der Abwesenheit zu deponieren – für den Fall eines Einbruchs von gewitzten Dieben, im unbewachten dunklen Waldrandhaus, welches ohne sie ja leerstand in den damaligen Jahren. In jenem Spätsommer jedoch war nicht genügend Zeit mehr gewesen, zur Bank zu gehen und so beschloss sie, das Gut möglichst raffiniert in einem Pappschächtelchen irgendwo im Hause zu verstecken. Was sie tat.
Nach ihrer Rückkehr konnte sie sich jedoch nicht mehr erinnern, wo genau sie das Gebinde voller Goldschmuck in der vorurlaublichen Eile verborgen hatte. Sie konnte es, trotz intensivster Sucherei, einfach nicht wiederfinden. „Im Keller irgendwo…“ – so sagte sie mir immer verzweifelt, in den ganzen folgenden Jahrzehnten. Und dass es so schade wäre, weil doch vor allem so sehr ideell wertvolle Dinge dabei seien.
Verdächtigte dann sogar die liebe russlanddeutsche Reinigungshilfe, in ihrer Gedächtnisnot. Diese Flausen trieb ich ihr empört stets schleunigst aus, bis sie kleinlaut aufgab und oft den Tränen nah zugab: Sie wisse es einfach nicht mehr. Und was für ein Teufel doch die Erinnerung sei.
Immer, wenn ich im Keller war, suchte ich, wenn Zeit war, ein wenig, hob diese Kiste einmal hoch, fasste ein anderes Mal hinter jenes Regal, durchsuchte die Taschen alter Wehrmachtsmäntel, öffnete kaum mehr zu öffnende alte Lebkuchen-Dosen oder begutachtete die beiden alten Milchkannen aus Aluminium in der alten Fluchtkiste aus Cuxhaven. Ich habe seit Jahren schon nach und nach den Keller ausgemistet und immer dachte ich aufmerksam an ihre Worte. Nichts. Nirgendwo. Selbst in ihren letzten Monaten, vor drei Jahren, als vieles schon hinweg dämmerte, kam sie immer wieder darauf zurück. Wo doch der Schmuck sein könnte, herrjeh! Und irgendwann dann, resignierend, ich glaube, es war 2 Monate vor ihrem Sterben, meinte sie angesichts des sich nähernden Todes und seuftzend: „Na gut, ich glaube, der Schmuck, weisst Du, der ist dann eben einfach… weg.“
(‚Das letzte Hemd hat keine Taschen‘, so möchte man hinzufügen. Das sagte sie ohnehin oft, auch als sie noch im Saft war.)
./.
Nach dem Ausräumen und Sichten des Hauses und seiner Innereien habe ich nun mit dem partiellen Rückbau mit schwerem Werkzeug begonnen. Die Kellerräume sind bereits seit 3 Wochen komplett geleert. Ich habe auch nochmals, in Gedenken an den Schmuckschatz, ein paar Öffnungen im fundamentierten Boden aus Stampfbeton („Spanier“ gossen den damals, mit Schubkarren, laut Bautagebuch) freigemacht. Und beleuchtet und gegraben. Nichts. Kein Schmuck im Keller. Also, so dachte auch ich zuletzt, der ist eben einfach weg. Wie gerne hätte ich ihr in den Himmel berichtet.
Gestern demontierte ich eine steinerne Heizungsabdeckung im Wohnzimmer. Der alte Heizkörper von 1964 wird erneuert werden. Die davor fest und schwer installierte Sitzbank aus massivem Teakholz muss dazu abgebaut werden. Als ich die zweite der steinernen Lamellen herausgeklopft hatte, gab das herbstschräge Sonnenlicht eine kleine längliche Pappschachtel, deponiert hinter der Banklehne auf dem seit 1964 verstaubten und mit uralten Spinnweben umflaumten Heizkörper preis. Auf dem Deckel noch lesbar ihre Schrift mit verblichenem, einst, Edding: „Tresor“.
Sofort wusste ich, das kann nur jener Schmuck sein. Und so war es dann auch. Sie hatte – seinerzeit noch beweglich offenbar – das Kistchen von unten unter erheblicher Körperverrenkung und Verdrehung ihres Unterarmes gegenüber dem Handgelenk auf die Oberseite der Heizung geschoben. Kein noch so gewiefter Dieb hätte es da jemals gefunden. Was sich ja, quasi, bewahrheitet hatte.
Ich musste so lachen.
Und herzen. In den Himmel. Wie gerne hätte ich ihr das berichtet – ihr, die zuletzt so unbeweglich nur noch im Rollstuhl saß. Kaum mehr als zwei Meter entfernt übrigens von meiner sonntäglichen Fundstelle. Auf ihrem Wohnzimmer- und Fernsehplatz. Vor 10 Jahren noch ohne Stock im Korbsessel, vor 9 Jahren ebenda mit Gehstock, vor 7 Jahren noch mit Rollator und zuletzt eben im Rollstuhl.
Schade ist, dass sie mir nun nicht mehr erzählen kann, von wem denn die seltsam-schöne amorphe Jugenstil-Brosche ist, ob der schöne Ring (mit den 3 Smaragden?) von Oma Mika aus Pillau stammt, ob das feine Armband, ein wenig Art Deco, aus den 20er-Jahren vielleicht ein Geschenk an sie ist von ihrem Haudegen-Papa oder warum die um 90° verdrehte mechanische Uhr am Goldarmband immer noch genau die Uhrzeit anzeigt, wenn man sie aufzieht, so wie ich das gestern Abend tat. Und von wem die ist. Vielleicht ja ein Hochzeitsgeschenk von meinem Papa an sie, von 1959?
Familiär weiblicherseits jedenfalls wurde schon aufleuchtendes Interesse angemeldet zur neugierig sensiblen Begutachtung der Fundstücke. Schmuck muss schließlich weitergetragen werden. Finde ich. Und nicht im Tresor liegen – oder in kleinen Pappschachteln weitergereicht werden, zur verdeckt diskret düsternen Aufbewahrung, mausoleenhaft. Generationenlang, fürchterlich. So gefällt mir das, besser: würde mir das gefallen. Und meiner ostpreussischen Ur-Oma Mika, über die ich so viel Liebevolles hörte mein Leben lang, soviel ich jedenfalls über sie weiß, vielleicht sicher möglicherweise ggf. – auch.
Es ergibt, am Ende der diesjährigen Herbsttage, schon einen einigermaßen sinnigen Sinn, dass dieser Fund eines außerordentlichen Primärdokumentes am Ende einer großen abendländischen Ausräumerei sowie eines klärenden Wegschmeißens steht.
<3